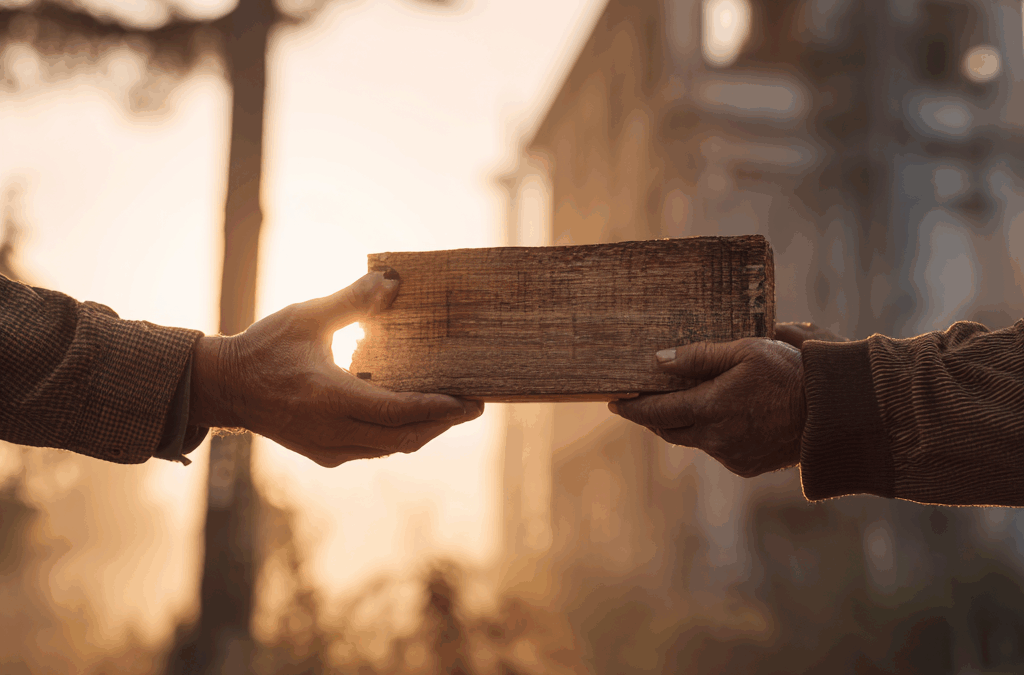Wenn Übergabe zur Systemfrage wird
Die Unternehmensnachfolge gilt als einer der sensibelsten Übergangsprozesse im Wirtschaftsleben. Für Familienunternehmen ist sie mehr als ein Rollenwechsel – sie ist ein emotionaler, finanzieller und struktureller Bruchpunkt, der nicht nur das Unternehmen, sondern auch die Familie tiefgreifend verändert.
Und doch wird dieser Prozess zunehmend von einer weiteren, externen Kraft überlagert: der Steuerpolitik. Genauer: der Erbschaftsteuer – einem Thema, das juristisch komplex, gesellschaftlich aufgeladen und politisch hochexplosiv ist.
In der öffentlichen Debatte wird die Erbschaftsteuer oft reduziert auf zwei Gegensätze: auf der einen Seite die Forderung nach mehr Gerechtigkeit durch Besteuerung großer Vermögen. Auf der anderen Seite der Ruf nach Bestandsschutz für Familienunternehmen, die Arbeitsplätze sichern, Ausbildung garantieren und regional verankert sind.
Doch wie so oft in politischen Auseinandersetzungen liegt die Wahrheit nicht in der Schlagzeile, sondern im Detail. Und genau dieses Detail entscheidet über den Fortbestand von tausenden mittelständischen Unternehmen in Deutschland.
Dieser Beitrag will die Zusammenhänge erklären, die Komplexität reduzieren und vor allem eines leisten: Orientierung für Unternehmer:innen, Nachfolger:innen und Berater:innen, die wissen wollen, was auf sie zukommt – und was jetzt zu tun ist. Er ersetzt keine Steuerberatung und dient lediglich als ein erster Überblick. Für eventuelle Abweichungen übernimmt der Autor keine Haftung.
1. Die Erbschaftsteuer in Deutschland – Systematik und Status quo
Die Erbschaftsteuer ist eine der ältesten Steuerarten in Deutschland – und zugleich eine der politisch sensibelsten. Ihr Grundprinzip ist einfach: Wenn Vermögen den Eigentümer wechselt – sei es durch Erbschaft oder Schenkung, entsteht ein steuerpflichtiger Vorgang.
Doch die Umsetzung ist alles andere als einfach. Sie hängt ab von:
-
der Beziehung zwischen Erblasser und Erwerber (Verwandtschaftsgrad)
-
der Art und Höhe des übertragenen Vermögens
-
den vorhandenen Freibeträgen und möglichen Verschonungen
Hier zunächst ein Überblick über die Grundstruktur der geltenden Regelungen:
📊 Tabelle 1: Freibeträge & Steuersätze (Stand 2025)
|
Erwerbergruppe |
Freibetrag |
Steuersatz (bis 75.000 €) |
Steuersatz (über 26 Mio. €) |
|---|---|---|---|
|
Ehegatte |
500.000 € |
7–30 % |
bis zu 30 % |
|
Kind/Enkel |
400.000 € / 200.000 € |
7–30 % |
bis zu 30 % |
|
Nichtverwandte |
20.000 € |
30–50 % |
bis zu 50 % |
Dabei ist wichtig: Die Steuersätze steigen progressiv – je höher das vererbte Vermögen, desto höher der Prozentsatz. Zudem gilt: Immobilien und insbesondere Betriebsvermögen können unter bestimmten Voraussetzungen ganz oder teilweise verschont werden.
Sonderfall Betriebsvermögen
Das deutsche Erbschaftsteuerrecht sieht zwei zentrale Verschonungsregeln für Unternehmensvermögen vor:
|
Verschonungsmodell |
Steuerfreiheit |
Behaltensfrist |
Bedingungen |
|---|---|---|---|
|
Regelverschonung |
85 % |
5 Jahre |
Mindestlohnsumme, Fortführung des Betriebs |
|
Optionsverschonung |
100 % |
7 Jahre |
strengere Vorgaben (u. a. keine Entnahmen) |
Diese Modelle sind mit zahlreichen Detailregeln verbunden: z. B. Lohnsummenprüfungen, Verwaltungsvermögensgrenzen, Rückfallregelungen.
Im Ergebnis bedeutet das: Die Erbschaftsteuer kann – je nach Gestaltung – entweder zur Nullbelastung oder zur existenzbedrohenden Liquiditätsfalle werden.
Besonders relevant ist das für mittelständische Familienunternehmen, deren Unternehmenswerte hoch, aber deren Liquiditätsreserven gering sind.
Und genau hier setzt die öffentliche und politische Kritik an.
2. Unternehmensnachfolge im Familienunternehmen – emotionale Verantwortung trifft strukturelle Komplexität
Die Unternehmensnachfolge in Familienunternehmen ist kein bloßer Eigentümerwechsel. Sie ist ein vielschichtiger, oft mehrjähriger Transformationsprozess, der weit über steuerliche oder juristische Fragestellungen hinausgeht.
Denn in kaum einem anderen Übergabeszenario greifen emotionale, finanzielle und organisatorische Dimensionenso tief ineinander wie bei der Nachfolge im Familienbetrieb.
2.1 Die emotionale Dimension: Abschied, Identität, Verantwortung
Viele Unternehmer:innen, die ihr Lebenswerk über Jahrzehnte aufgebaut haben, verbinden mit „ihrer Firma“ mehr als nur wirtschaftliche Interessen. Sie steht für Identität, für Sinn, für Gestaltungsmacht.
Die Übergabe – ob an die nächste Generation, an Mitarbeitende oder an Externe – ist daher immer auch ein Loslösungsprozess.
Und für die Nachfolger:innen ist sie nicht minder komplex:
Sie übernehmen nicht nur ein Unternehmen, sondern eine familiäre Erwartungshaltung, eine Kultur, ein Vermächtnis.
Diese emotionale Tiefe ist charakteristisch – aber sie macht die Nachfolge auch verwundbar:
-
Entscheidungen werden aufgeschoben
-
Steuerfragen verdrängt
-
Vermögenswerte über- oder unterschätzt
-
Familieninteressen über betriebliche Notwendigkeiten gestellt
Erbschaftsteuerliche Konsequenzen kommen in diesem Spannungsfeld häufig zu spät oder zu technokratisch auf die Agenda – und treffen auf eine Realität, die nicht vorbereitet ist.
2.2 Die strukturelle Seite der Nachfolge: Organisation, Finanzierung, Planungstiefe
Neben den persönlichen Faktoren ist die Unternehmensnachfolge ein hochkomplexes organisatorisches Projekt, das in der Praxis oft unterschätzt wird. Es betrifft:
-
die Rechtsform (z. B. GmbH, KG, Stiftung, Holdingstruktur)
-
die Vermögensverhältnisse (Eigenkapital, stille Reserven, private Entnahmen)
-
die Managementstruktur (operative Geschäftsführung vs. Eigentümerfunktion)
-
die interne Governance (Beirat, Familienrat, Gesellschaftsvertrag)
-
die Finanzierung der Übergabe (Kauf, Schenkung, Teilverkauf, Vermietung)
Erbschaftsteuerlich besonders relevant sind die Punkte:
|
Strukturfrage |
Relevanz für Erbschaftsteuer |
|---|---|
|
Einzelunternehmen vs. GmbH |
Betriebsvermögen wird unterschiedlich bewertet |
|
Holdingstrukturen |
Möglichkeit zur Vermögensbündelung und Bewertung |
|
Entnahmen & Rücklagen |
Einfluss auf Verwaltungsvermögensquote |
|
Gesellschaftsverträge |
Vorweggenommene Erbfolge steuerlich optimierbar |
Die Gestaltung der Nachfolge entscheidet somit maßgeblich darüber, ob eine Erbschaftsteuerlast entsteht – und wenn ja, in welcher Höhe und zu welchem Zeitpunkt.
Gerade in inhabergeführten Familienunternehmen wird diese Gestaltung aber häufig zu spät oder unter emotionalem Druck vorgenommen – mit erheblichen Risiken.
2.3 Typische Fallstricke aus der Praxis
Die Erfahrung zeigt, dass viele Unternehmen trotz hoher Steuerberatungskompetenz in eine erbschaftsteuerliche Schieflage geraten – aus organisatorischen, nicht steuerlichen Gründen. Einige Beispiele:
-
Ein Nachfolger wird ungleich behandelt – und es entsteht eine Schenkung mit Steuernachzahlungspflicht.
-
Verwaltungsvermögen (z. B. Immobilien, Wertpapiere) im Betriebsvermögen überschreitet die Grenzen – Verschonung wird teilweise oder vollständig versagt.
-
Die Lohnsummenregelung wird durch Personalanpassungen verletzt – und führt zu rückwirkender Steuerpflicht.
-
Keine rechtzeitige Vorbereitung der Finanzierung – und damit keine Möglichkeit zur Stundung der Erbschaftsteuer.
-
Testament oder Erbvertrag fehlt – was zur Anwendung der gesetzlichen Erbfolge führt, mit unerwünschten Konsequenzen.
Diese Praxisfälle zeigen: Die Unternehmensnachfolge ist nicht nur ein strategisches oder familiäres Thema – sie ist ein steuerlich riskanter Vorgang, der systematisch vorbereitet werden muss.
2.4 Fazit dieses Abschnitts
Die Verbindung zwischen Unternehmensnachfolge und Erbschaftsteuer ist keine Nebensächlichkeit – sie ist zentral für das Gelingen des Übergangs.
Die Steuer wirkt wie ein Brennglas:
-
Auf die strukturelle Vorbereitung
-
Auf die emotionale Klarheit
-
Auf die Fähigkeit, Komplexität zu managen
Wer diese Zusammenhänge ignoriert, läuft Gefahr, sein Unternehmen nicht wegen mangelnden Erfolgs, sondern wegen mangelnder Steuerplanung zu gefährden.
3. Was die Erbschaftsteuer für Nachfolgeregelungen bedeutet – in der Praxis
In der Theorie ist das deutsche Erbschaftsteuerrecht ein komplexes, aber strukturiertes System. In der Praxis wirkt es jedoch oft wie ein Puzzle, dessen Teile nicht richtig zusammenpassen – insbesondere dann, wenn es um die Übergabe von Unternehmen geht.
Denn anders als bei Geld- oder Immobilienvermögen handelt es sich bei Betriebsvermögen um eine lebendige Struktur: mit Mitarbeitenden, Maschinen, Kundenverträgen, Markenwerten, Haftungsrisiken – und in vielen Fällen mit gewachsenen, oft schwer bewertbaren Strukturen.
Was also passiert, wenn ein Unternehmen im Zuge einer Nachfolge vererbt oder verschenkt wird? Und wie wird das steuerlich konkret behandelt?
3.1 Der Bewertungsansatz: Ertragswert statt Substanzwert
Die Bewertung von Unternehmensvermögen für erbschaftsteuerliche Zwecke erfolgt im Regelfall nach dem vereinfachten Ertragswertverfahren. Dabei wird der durchschnittliche nachhaltige Jahresertrag der letzten drei bis fünf Jahre mit einem Kapitalisierungsfaktor multipliziert – derzeit liegt dieser bei 13,75.
Beispielrechnung:
|
Kennziffer |
Wert |
|---|---|
|
Durchschnittlicher Jahresertrag |
500.000 € |
|
Kapitalisierungsfaktor (2025) |
13,75 |
|
Ertragswert laut Bewertung |
6.875.000 € |
Dieser Wert bildet die Grundlage für die Steuerbemessung – nicht der Buchwert, nicht der Marktwert und nicht der Verkaufswert. Das hat Vor- und Nachteile:
-
Vorteile: Stabilität, Planbarkeit, oft günstiger als Marktwert
-
Nachteile: Verzerrung bei stark schwankenden Ergebnissen, keine Rücksicht auf stille Reserven oder Krisen
In der Praxis bedeutet das: Selbst Unternehmen mit vergleichsweise bescheidenem Gewinn, aber konstanter Ertragshistorie können in Millionenhöhe steuerlich bewertet werden – auch wenn keine entsprechende Liquidität vorhanden ist.
3.2 Die Wirkung der Verschonungsregelungen
Wie bereits im ersten Abschnitt dargestellt, existieren zwei zentrale Verschonungsmodelle:
|
Modell |
Steuerfreiheit |
Voraussetzungen |
|---|---|---|
|
Regelverschonung |
85 % |
5 Jahre Behaltensfrist, max. 20 % Verwaltungsvermögen |
|
Optionsverschonung |
100 % |
7 Jahre, Lohnsummenquote ≥ 400 %, max. 10 % Verw.-Vermögen |
Wichtig ist hier:
Die Verschonung gilt nur, wenn die Bedingungen vollständig erfüllt sind. Wird auch nur eine Bedingung gerissen, kann es zur rückwirkenden Besteuerung kommen – inklusive Zinsen.
Praktischer Fall:
Ein Nachfolger übernimmt einen Familienbetrieb mit 50 Mitarbeitenden. In den Folgejahren wird die Belegschaft reduziert (z. B. durch Digitalisierung oder Verlagerung). Die Lohnsummenquote sinkt unter die Vorgabe – und die vollständige Verschonung wird nachträglich aufgehoben. Die Steuerpflicht entsteht – oft ohne ausreichend Rücklagen.
3.3 Die Rolle von Verwaltungsvermögen
Verwaltungsvermögen ist Betriebsvermögen, das nicht aktiv im Produktions- oder Dienstleistungsprozess eingesetzt wird. Dazu zählen:
-
Vermietete Immobilien
-
Wertpapiere
-
liquide Mittel ohne betriebliche Bindung
-
Oldtimer oder Kunstwerke im Firmenvermögen
Der Gesetzgeber will damit verhindern, dass Privatvermögen unter dem Schutzschild der Betriebsverschonung „durchgeschleust“ wird. Die Grenzen sind:
-
Regelverschonung: max. 50 % Verwaltungsvermögen
-
Optionsverschonung: max. 10 %
Problematisch ist dabei:
Viele mittelständische Unternehmen besitzen vermietete Immobilien (z. B. die Halle der Schwesterfirma), Beteiligungen oder überschüssige Liquidität – und fallen damit ungewollt unter die strenge Definition von Verwaltungsvermögen.
Das kann dazu führen, dass z. B. 30 % des Unternehmenswerts voll versteuert werden müssen, obwohl sie faktisch zur Finanzierung des operativen Geschäfts beitragen.
3.4 Die Liquiditätslücke – das unterschätzte Nachfolgerisiko
Besonders gefährlich ist die Kombination aus hoher steuerlicher Bewertung und niedriger verfügbarer Liquidität. Denn: Die Steuer entsteht zum Zeitpunkt der Erbschaft – und muss (theoretisch) binnen eines Monats beglichen werden.
Die Stundungsregel des § 28 ErbStG erlaubt zwar eine siebenjährige Ratenzahlung, jedoch nur, wenn das Unternehmen fortgeführt wird und die Fortführung gefährdet wäre – was in der Praxis oft schwer nachzuweisen ist.Zudem sind viele Finanzämter bei der Gewährung restriktiv.
Beispielhafte Berechnung:
|
Parameter |
Wert |
|---|---|
|
Steuerpflichtiger Wert |
6.875.000 € |
|
Verschonung (85 %) |
– 5.843.750 € |
|
Zu versteuern |
1.031.250 € |
|
Steuer (bei 15 %) |
154.688 € |
|
Zahlungsziel |
1 Monat (theoretisch) |
|
Verfügbare liquide Mittel im Unternehmen |
70.000 € |
Ergebnis: Liquiditätslücke trotz Verschonung.
Besonders kritisch bei Übergaben an mehrere Nachfolger:innen oder bei gleichzeitigen Auszahlungen an weichende Erben.
3.5 Die (zu) späte Erkenntnis – wie Nachfolgen an der Steuer scheitern
In meiner Praxis habe ich zahlreiche Fälle erlebt, in denen an sich gesunde, profitable Familienunternehmen durch die steuerliche Nachfolge überfordert waren – weil sie:
-
die Bewertung zu spät geprüft haben
-
auf vollständige Verschonung vertraut haben
-
die Finanzierung nicht vorbereitet hatten
-
Governance-Strukturen fehlten
-
oder schlicht keine Notfallregelung (z. B. bei Todesfall) hinterlegt war
Dabei hätte oft eine vorausschauende, integrierte Nachfolgeplanung mit steuerlicher Simulation, Vermögensstrukturierung und familieninterner Kommunikation gereicht, um schwerwiegende Folgen zu vermeiden.
Fazit
Die Erbschaftsteuer ist kein rein fiskalisches Thema – sie wirkt tief in die Substanz von Unternehmen hinein.
Wer die Übergabe nicht rechtzeitig strukturiert – mit einem klaren Blick auf Bewertung, Verschonung, Liquidität und Governance – riskiert, dass nicht nur Steuern anfallen, sondern auch Investitionen verschoben, Mitarbeitende verunsichert oder strategische Spielräume verloren gehen.
Die gute Nachricht: All das ist planbar.
Aber eben nicht am Tag der Erbschaft – sondern idealerweise 3–5 Jahre davor.
4. Die Reformdebatte 2025 – zwischen Gerechtigkeit und Bestandsschutz
Während viele Familienunternehmer:innen versuchen, ihre Nachfolgeplanung mit Augenmaß und vorausschauender Vernunft zu gestalten, entwickelt sich parallel auf politischer Ebene eine Grundsatzdebatte über die Reform der Erbschaftsteuer.
Diese Debatte ist mehr als eine technische Steuerdiskussion – sie ist ein gesellschaftspolitischer Verhandlungstisch, an dem sich Fragen von Leistung, Privileg, Verantwortung und Zukunftsfähigkeit bündeln.
Und sie ist hochaktuell: Im Vorfeld der Bundestagswahl im Februar 2025, parallel zur erwarteten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Rechtmäßigkeit der bestehenden Verschonungsregeln, hat sich die Tonlage deutlich verschärft.
4.1 Der politische Kontext – warum die Diskussion jetzt eskaliert
Drei Entwicklungen wirken als Katalysatoren:
-
Soziale Spannungen: Die Vermögensverteilung in Deutschland wird als zunehmend ungleich wahrgenommen. Studien belegen: Die reichsten 10 % besitzen mehr als 60 % des Nettovermögens. Erbschaften sind zu einem zentralen Verstärker sozialer Ungleichheit geworden.
-
Haushaltskrise des Staates: Die Schuldenbremse, strukturelle Haushaltsdefizite, steigende Sozialausgaben und geopolitische Herausforderungen (Energie, Verteidigung, Digitalisierung) erhöhen den Druck auf zusätzliche Einnahmen.
-
Populistische Zuspitzung: Parteien nutzen das Thema Erbschaftsteuer als Symbolpolitik – entweder für soziale Gerechtigkeit oder für Eigentumsschutz. Die Konsequenz: Polarisierte Positionen statt sachlicher Reformvorschläge.
4.2 Die aktuellen Vorschläge – ein Blick auf die Positionen
Die politischen Parteien haben 2025 deutlich Position bezogen. Die folgende Tabelle gibt einen systematischen Überblick:
📊 Tabelle 2: Reformvorschläge im Überblick (Stand 09/2025)
|
Partei |
Freibeträge |
Betriebsvermögen |
Steuersätze |
Weitere Vorschläge |
|---|---|---|---|---|
|
CDU/CSU |
Inflationsanpassung (automatisch) |
Beibehaltung, Bürokratieabbau |
unverändert |
Eigenheim steuerfrei, regionale Differenzierung |
|
SPD |
Anhebung bei kleinen Erbschaften |
Einschränkung der Verschonung |
Anhebung bei >3 Mio. € auf 30 % |
Zweckbindung: Bildung, Soziales |
|
Grüne |
moderate Erhöhung |
keine 100 %-Verschonung mehr |
progressiv bis 40 % |
Mindestlohnsummen, Klimainvestitionen |
|
FDP |
automatische Anpassung |
Schutz des Eigentums |
Deckelung bei 30 % |
Verwaltungsvereinfachung |
|
Linke |
150.000 € (300.000 € für Bedürftige) |
radikale Einschränkung |
bis zu 60 % |
20 Jahre Tilgung, Anti-Schlupfloch-Regelungen |
|
BSW |
vereinheitlicht |
keine Ausnahmen |
Pauschalsteuer auf Vermögen |
Fokus auf Kapitalbesteuerung |
|
AfD |
komplette Abschaffung |
entfällt |
entfällt |
gegen Umverteilungspolitik |
Diese Spannbreite zeigt: Die Diskussion um die Erbschaftsteuer ist keine Frage von technischen Details, sondern eine Machtfrage.
Eine Frage danach, wem das System dienen soll – und wer es mitträgt.
4.3 Die juristische Dimension – das Bundesverfassungsgericht mischt mit
Besonders brisant: Das Bundesverfassungsgericht prüft derzeit erneut die Verschonungsregelungen für Unternehmensvermögen. Bereits 2014 hatte es geurteilt, dass Ausnahmen nur zulässig sind, wenn sie zielgerichtet und verhältnismäßig sind.
Die aktuelle Kritik richtet sich vor allem gegen:
-
die Optionsverschonung von 100 %, die auch für große Konzerne mit Milliardenvermögen möglich ist
-
die Verwaltungsvermögensregelung, die Umgehung über Holdingstrukturen zulässt
-
die fehlende Verhältnismäßigkeit zwischen entgangenen Steuereinnahmen und gesamtwirtschaftlichem Nutzen
Ein Urteil, das die bestehenden Regelungen kippt oder stark einschränkt, würde den politischen Druck auf eine schnelle Reform massiv erhöhen – und Nachfolgeplanungen binnen Monaten entwerten.
4.4 Die öffentliche Meinung – Zustimmung zur Besteuerung großer Erbschaften
Umfragen (z. B. Forsa, September 2025) zeigen:
-
57 % der Bevölkerung sprechen sich für höhere Steuern auf große Erbschaften aus
-
Selbst unter Unionswählern gibt es eine Mehrheit für gezielte Besteuerung ab 5 Mio. €
-
Die Zustimmung zur kompletten Abschaffung der Steuer liegt unter 15 %
Das zeigt: Der gesellschaftliche Trend geht in Richtung stärkerer Belastung großer Vermögen – bei gleichzeitiger Schonung kleiner und mittlerer Erbschaften.
Für Familienunternehmen bedeutet das:
Öffentliche Akzeptanz wird künftig nicht allein durch wirtschaftliche Leistung erzeugt – sondern durch Glaubwürdigkeit, Nachvollziehbarkeit und transparente Beiträge zum Gemeinwohl.
Fazit
Die Erbschaftsteuerreform ist kein isoliertes Gesetzesvorhaben – sie ist ein gesellschaftliches Signal. Ein Signal dafür,
-
wie wir mit Vermögen umgehen, das nicht erarbeitet, sondern vererbt wurde
-
wie wir Unternehmen zwischen Generationen stabil halten
-
und wie wir den Staat finanzieren, ohne seine Grundlage – das Unternehmertum – zu schwächen
Für Familienunternehmen ist die Reformdebatte deshalb keine abstrakte Diskussion. Sie ist ein direkter Eingriff in die Gestaltungsfreiheit der nächsten Generation.
Die nächste Frage lautet: Wie sehen realistische Kompromisslinien aus?
Und: Was kann der Mittelstand selbst tun, um vorbereitet zu sein – und gehört zu werden?
5. Analyse der Reformvorschläge – wer fordert was und mit welcher Wirkung?
Angesichts der emotional geführten Debatte ist es hilfreich, die politischen Positionen nicht nur nach Parteifarbe, sondern nach Gestaltungslogik und praktischer Wirkung zu sortieren. Denn viele Forderungen klingen ähnlich – entfalten aber in der Realität höchst unterschiedliche Konsequenzen für Unternehmensnachfolge, Beschäftigung und Vermögenserhalt.
In diesem Abschnitt analysiere ich die vier zentralen Reformbereiche und zeige, was die jeweiligen Vorschläge für Unternehmerfamilien konkret bedeuten.
5.1 Freibeträge: Anpassung, Staffelung oder Reduktion?
Die Diskussion um Freibeträge ist ein Balanceakt zwischen Gerechtigkeit und Schutz des familiären Eigentums.
Status quo:
-
500.000 € für Ehegatten
-
400.000 € für Kinder
-
Keine automatische Anpassung seit 2009
-
Reale Entwertung durch Inflation: über 30 %
Vorschläge im Überblick:
|
Modell |
Parteien |
Wirkung auf Familienunternehmen |
|---|---|---|
|
Automatische Indexierung |
CDU, FDP |
Planbarkeit, kein realer Anstieg der Steuerlast |
|
Staffelung nach Vermögenshöhe |
SPD, Grüne |
Entlastung kleiner Erben, Mehrbelastung bei Großvermögen |
|
Reduktion auf 150.000 € |
Linke |
Hohe Steuerlast selbst bei operativer Nachfolge |
|
Abschaffung der Freibeträge |
BSW (implizit) |
radikaler Systemwechsel, politisch kaum realistisch |
Analyse:
Für Unternehmensnachfolgen sind hohe Freibeträge essenziell, um familiäre Übergaben nicht künstlich zu erschweren – vor allem wenn mehrere Kinder beteiligt sind. Die Idee einer staffelbezogenen Indexierung (z. B. voller Freibetrag bis 2 Mio. €, reduzierte Wirkung ab 5 Mio. €) erscheint am gerechtesten und steuerlich tragbar.
5.2 Betriebsvermögen: Verschonung oder Gleichbehandlung?
Hier spaltet sich die Diskussion in zwei Lager:
-
Die einen sehen in der Verschonung eine wirtschaftspolitische Notwendigkeit
-
Die anderen betrachten sie als ungerechtfertigtes Schlupfloch
Status quo:
85 % bzw. 100 % Verschonung möglich
An Voraussetzungen gebunden (Behaltensfrist, Lohnsummenregel, Verwaltungsvermögensgrenzen)
Vorschläge im Überblick:
|
Modell |
Parteien |
Wirkung auf Familienunternehmen |
|---|---|---|
|
Beibehaltung & Vereinfachung |
CDU, FDP |
Planungssicherheit, geringere Rechtsunsicherheit |
|
Einschränkung & Zielbindung |
SPD, Grüne |
höhere Anforderungen, Risiken bei Nachfolgekonstrukten |
|
Abschaffung der Vollverschonung |
Linke |
selbst bei Fortführung hohe Steuerlast möglich |
|
Keine Unterscheidung mehr |
BSW |
faktisches Ende der privilegierten Unternehmensnachfolge |
Analyse:
Eine zielgerichtete Betriebsverschonung mit klaren Bedingungen bleibt volkswirtschaftlich sinnvoll – etwa wenn Arbeitsplätze gesichert, Investitionen nachgewiesen und Nachfolgestrukturen transparent sind. Eine vollständige Gleichbehandlung von Privat- und Betriebsvermögen würde externe Nachfolgen und kleinere Übergaben faktisch unmöglich machen.
5.3 Stundung und Tilgung: Liquidität oder Verlust?
Viele Reformpläne vernachlässigen den praktischen Liquiditätsengpass, der bei Übergaben entsteht. Die aktuellen Stundungsmöglichkeiten (§ 28 ErbStG) sind oft zu restriktiv.
Vorschläge im Überblick:
|
Modell |
Parteien |
Wirkung für Familienunternehmen |
|---|---|---|
|
Tilgung über 7–10 Jahre |
CDU, FDP |
realistische Gestaltung, erleichtert Investitionsplanungen |
|
20 Jahre Tilgung mit Indexierung |
Linke |
hilfreich, aber in Kombination mit hohen Steuersätzen teuer |
|
Abschaffung der Stundung |
nicht vorgesehen |
unrealistisch, wäre verfassungsrechtlich problematisch |
Analyse:
Ein modernes, digitales Stundungsmodell, das sich am Cashflow und Fortführungsgrad orientiert, wäre nicht nur steuerlich tragbar, sondern auch politisch vermittelbar. Es würde Nachfolger:innen ermöglichen, zu führen – nicht sofort zu zahlen.
5.4 Bewertung: Komplexität reduzieren – Transparenz schaffen
Bewertung ist ein neuralgischer Punkt, weil sie die Verbindung von Realität und Steuerrecht herstellt – und dabei oft große Lücken entstehen.
Vorschläge im Überblick:
|
Maßnahme |
Parteien |
Wirkung auf Unternehmensnachfolge |
|---|---|---|
|
Standardisierte Verfahren („Safe Harbours“) |
FDP, CDU |
mehr Rechtssicherheit, weniger Streit mit Finanzämtern |
|
Digitalisierung des Verfahrens |
alle |
Umsetzung technisch möglich, juristisch aufwendig |
|
Verbindliche Mindestbewertung |
Grüne, SPD |
Gefahr der Überbewertung in strukturschwachen Regionen |
Analyse:
Ein Mittelweg wäre sinnvoll: Standardisierte Bewertungsmodelle für KMU, die freiwillig gewählt werden können und eine Streitsicherheit bieten – ohne die Einzelfallprüfung gänzlich zu ersetzen. Das wäre besonders wichtig für kleinere und mittlere Nachfolgen.
Fazit
Die politischen Vorschläge zur Erbschaftsteuerreform lassen sich in drei Kategorien einteilen:
-
Systemstabilisierend (z. B. automatische Freibetragsanpassung, Tilgungsmodelle)
-
Systemtransformierend (z. B. progressivere Verschonung, Zielbindung von Mitteln)
-
Systemsprengend (z. B. Abschaffung von Verschonungen, pauschale Gleichbehandlung)
Für den deutschen Mittelstand – und insbesondere für familiengeführte Unternehmen – liegt die Wahrheit vermutlich zwischen 1 und 2. Eine radikale Umstellung würde Nachfolgen unmöglich machen und Innovation hemmen. Eine vollständige Beibehaltung würde Legitimitätsprobleme verstärken.
Der Weg aus diesem Dilemma führt über einen ehrlichen, strukturierten, faktenbasierten Kompromiss. Und genau den sucht man in der politischen Debatte derzeit noch vergeblich.
6. Was Familienunternehmen jetzt wissen müssen – Handlungsempfehlungen
Nachfolgeplanung ist kein Einmalevent. Sie ist ein fortlaufender Prozess – strategisch, rechtlich, emotional und finanziell. Die aktuelle Erbschaftsteuerreform macht deutlich: Wer in Zukunft erfolgreich übergeben will, braucht heute strukturelle Klarheit.
Im Folgenden stelle ich sechs konkrete Handlungsfelder vor, in denen Familienunternehmen jetzt aktiv werden sollten – unabhängig vom konkreten Zeitpunkt der Übergabe.
6.1 Frühzeitige Simulation der Steuerlast
Die erste und wichtigste Maßnahme: Kennen Sie Ihre Zahlen.
Lassen Sie Ihre Erbschaftsteuersituation auf Basis der aktuellen und möglichen zukünftigen Rechtslage simulieren – inklusive:
-
Ertragswertschätzung (ggf. mit Schwankungsbandbreiten)
-
Verwaltungsvermögensquote
-
Test verschiedener Verschonungsmodelle (85 % vs. 100 %)
-
Auswirkungen unterschiedlicher Bewertungsverfahren
-
Eventuelle Lohnsummenrisiken bei Mitarbeiterreduktionen
Tipp: Nutzen Sie Szenarien. Denken Sie in „Was-wäre-wenn“-Logik – Tod des Inhabers, Verkauf vor Übergabe, Übergabe an Dritte, Beteiligung mehrerer Kinder.
6.2 Strukturierung des Vermögens – Betriebsvermögen trennen
Viele steuerliche Probleme in der Nachfolge entstehen dadurch, dass Betriebs- und Privatvermögen miteinander vermischt sind – z. B. durch vermietete Immobilien, Wertpapierbestände oder „ruhendes Kapital“ in der Bilanz.
Maßnahmen:
-
Überprüfung der Verwaltungsvermögensquote
-
Bildung klarer Strukturen: z. B. Trennung von operativer GmbH und Immobilienbesitz
-
Gründung einer Holding, wenn betriebswirtschaftlich sinnvoll
-
Dokumentation von Funktionszusammenhängen (z. B. warum bestimmte Vermögenswerte betrieblich notwendig sind)
Ziel: Vermeidung von unerwünschtem Überschreiten der Verschonungsgrenzen (10 % bzw. 20 %)
6.3 Bewertung aktiv gestalten
Erbschaftsteuer bemisst sich nach dem steuerlich anerkannten Wert – nicht nach dem „gefühlten“ oder bilanziellen. Hier lassen sich über transparente, nachvollziehbare, professionell vorbereitete Bewertungsansätze Spielräume nutzen.
Empfehlungen:
-
Vorweggenommene Bewertung auf Basis des vereinfachten Ertragswertverfahrens
-
Alternativ: Gutachten für den Substanzwert oder den Marktwert (wenn günstiger)
-
Vergleich von Bewertungsmethoden und deren Steuerwirkung
-
Prüfung auf Safe-Harbour-Modelle, wenn künftig gesetzlich geregelt
Wichtig: Bewertung ist kein reiner Steuermechanismus – sie beeinflusst auch familiäre Ausgleichszahlungen und externe Nachfolgeangebote.
6.4 Governance regeln – Übergabe strukturell ermöglichen
Erbschaftsteuer trifft nicht nur das Unternehmen – sie trifft die Struktur dahinter. Deshalb ist ein klares Governance-System entscheidend:
-
Wer ist Gesellschafter?
-
Wer ist Geschäftsführer?
-
Welche Rolle haben nicht operativ tätige Familienmitglieder?
-
Wie werden Konflikte geregelt (z. B. durch Beirat, Familienverfassung, Mediation)?
-
Wie wird Transparenz in der Finanzierung und Steuerstrategie hergestellt?
Praxis-Tipp: Eine klare Governance-Struktur erleichtert nicht nur die Steuerplanung, sondern auch die Kommunikation mit Finanzverwaltung und Kreditgebern.
6.5 Liquidität frühzeitig sichern
Selbst mit Verschonung bleibt eine Reststeuerlast oder andere Verpflichtung (z. B. Ausgleich an weichende Erben, Rücklagen für Stundung, Finanzierung von Investitionen).
Daher gilt:
-
Aufbau liquider Mittel mit Zweckbindung für Nachfolge
-
Einbindung von Finanzierungsoptionen (Banken, stille Beteiligungen, Familienpooling)
-
Vorbereitung auf mögliche Stundungsszenarien
-
Entwicklung eines „Worst Case“-Szenarios: Was tun, wenn keine Verschonung greift?
Beispiel: Ein Unternehmen mit 7 Mio. € Ertragswert und 100 % Verschonung kann durch kleine Strukturfehler plötzlich 1,2 Mio. € Steuerpflicht auslösen – und muss dafür Kapital bereitstellen.
6.6 Kommunikation innerhalb der Familie – und mit externen Partnern
Nachfolgeplanung und Steueroptimierung sind nicht nur Zahlenthemen – sie sind Beziehungsthemen.
Deshalb gilt: Offen sprechen, früh planen, gemeinsam entscheiden. Besonders wenn mehrere Geschwister beteiligt sind oder operative und nicht-operative Familienmitglieder betroffen sind.
Fragen, die Sie klären sollten:
-
Welche Rolle wollen Nachfolger:innen übernehmen?
-
Welche Erwartungen haben weichende Familienmitglieder?
-
Wie wird Gerechtigkeit empfunden?
-
Welche Auswirkungen haben Steuern auf die mögliche Nachfolgeform (z. B. Verkauf, Stiftung, Management-Buy-In)?
-
Welche Kommunikationsstrategie verfolgt das Unternehmen gegenüber Finanzamt, Mitarbeitenden und Öffentlichkeit?
Fazit: Wer offen kommuniziert, schafft nicht nur Vertrauen, sondern auch die Voraussetzung für steuerlich tragfähige Lösungen.
Fazit
Die Erbschaftsteuer ist kein „externer Schock“ – sie ist ein planbares Element im Nachfolgeprozess. Aber sie verlangt einen ganzheitlichen Blick auf Struktur, Bewertung, Liquidität und Familie.
Die gute Nachricht:
Jede dieser Dimensionen lässt sich gestalten.
Die schlechte:
Wer nicht gestaltet, wird gestaltet.
Schlussgedanken: Übergabe braucht Vertrauen – in die nächste Generation und in den Staat
Die Diskussion über die Erbschaftsteuerreform ist mehr als ein politischer Streit um Prozentsätze. Sie ist ein Gradmesser dafür, wie wir als Gesellschaft über Verantwortung, Vermögen, Gerechtigkeit und Zukunft denken.Und sie ist ein Prüfstein für Familienunternehmen, die an der Schnittstelle zwischen privater Identität und öffentlicher Erwartung agieren.
Was mir in der aktuellen Debatte fehlt, ist das verbindende Element:
Weder ist jede Erbschaft ein ungerechtes Privileg, noch ist jede Steuerforderung ein Angriff auf Unternehmertum. Es braucht ein Gleichgewicht aus Ermöglichung und Verpflichtung, aus Bestandsschutz und Veränderungsbereitschaft.
Familienunternehmen sind nicht die Ausnahme – sie sind die Regel im deutschen Mittelstand. Und doch behandelt die politische Debatte sie oft wie Sonderfälle: entweder als Schutzbedürftige oder als Ausweichende. Beides wird ihnen nicht gerecht.
Eigentum ist kein Freibrief – aber auch kein Freiwild.
Was Übergabe wirklich braucht, ist Vertrauen:
-
In die nächste Generation, dass sie führen kann – auch unter neuen Bedingungen.
-
In Strukturen, die fair und planbar sind – nicht opportunistisch oder überkomplex.
-
Und in einen Staat, der nicht nur nimmt, wenn es eng wird, sondern gestaltet, wenn es darauf ankommt.
Die Reform der Erbschaftsteuer kann – richtig gemacht – ein Impuls sein:
-
Für mehr Transparenz in der Bewertung
-
Für gerechtere Verteilung ohne Substanzverlust
-
Für unternehmerische Nachfolge, die nicht aus Angst verzögert wird, sondern mit Weitsicht erfolgt
Aber sie kann auch das Gegenteil bewirken:
-
Wenn populistische Reflexe über Reformfähigkeit siegen
-
Wenn legitime Nachfolgeprozesse durch Komplexität blockiert werden
-
Oder wenn Eigentum moralisch delegitimiert wird, statt es systemisch einzuordnen
Ich plädiere für eine Reform mit Maß, mit Mut – und mit strukturellem Blick auf Familienunternehmen.
Denn was hier vererbt wird, ist nicht nur Kapital. Es sind Werte, Beziehungen, Erfahrungen – und oft die Lebenswerke ganzer Generationen.
Drei letzte Empfehlungen für Unternehmer:innen in eigener Sache
-
Warten Sie nicht auf den Gesetzgeber.
Wer heute seine Nachfolge nicht vorbereitet, verliert Gestaltungsspielraum – unabhängig davon, wie die Reform am Ende aussieht.
-
Holen Sie sich systemisch denkende Partner.
Steuerberater:innen, Jurist:innen, Nachfolgeexpert:innen – idealerweise vernetzt und interdisziplinär. Nachfolge ist kein Ein-Mandat-Thema.
-
Positionieren Sie sich öffentlich.
Als Stimme des verantwortungsvollen Unternehmertums. Als jemand, der bereit ist, zu leisten – aber auch fragt, wofür. Gerade jetzt ist Klartext gefragt.
In eigener Sache
Wenn Sie sich aktuell mit der Frage beschäftigen, wie Sie Ihr Familienunternehmen übergeben – an Kinder, Mitarbeitende oder Externe –, dann lade ich Sie ein: Kommen Sie ins Gespräch.
Ich begleite Familienunternehmen seit über 20 Jahren – in Transformationen, Nachfolgen und strategischen Wendepunkten. Aus Erfahrung. Und aus Überzeugung, dass Eigentum mehr ist als Kapital: Es ist Verpflichtung mit Zukunft.
Schreiben Sie mir: [neusser@phalanx.de]