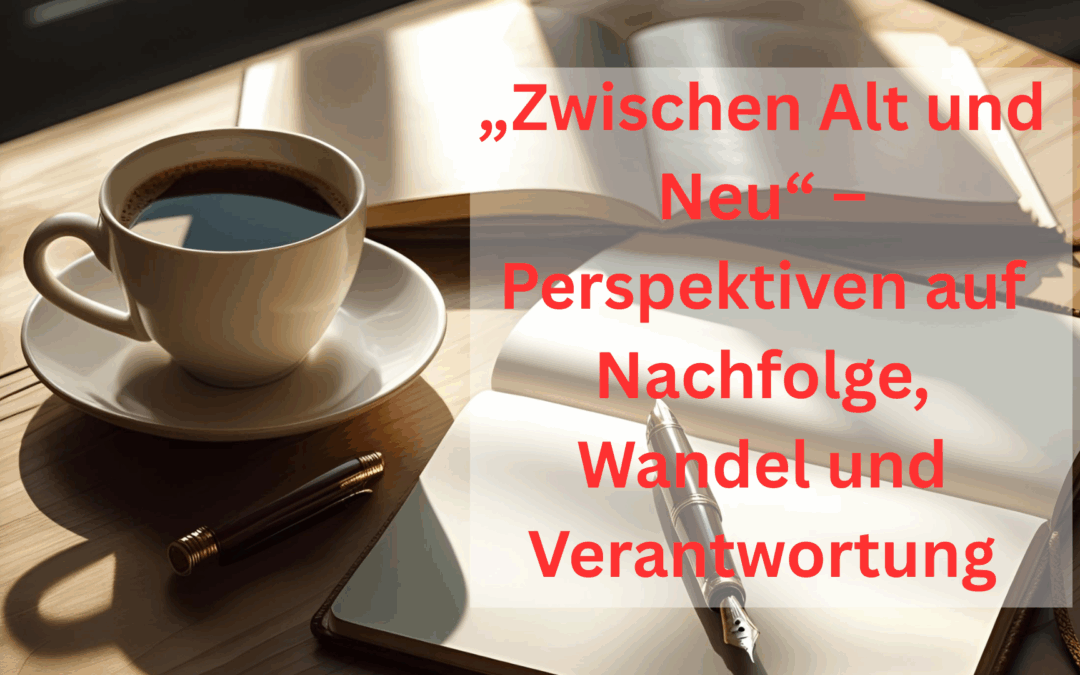Die vergangene Woche war für mich eine Woche der doppelten Perspektive: Einerseits habe ich wieder an meiner Thesis gearbeitet und mich mit den Mechanismen externer Nachfolge in Familienunternehmen beschäftigt – einem Thema, das mich nicht nur als Forscher, sondern auch als Berater und Mensch tief bewegt. Andererseits stieß ich auf einen Artikel, der mich innehalten ließ. Das Interview mit Annemarie Heyl, Mitgründerin von Kale & Me, beschreibt mit großer Offenheit den Zusammenbruch ihres Familienunternehmens – und den Neuanfang danach. Ihr Satz „Es gibt ein Leben nach dem Familienunternehmen“ hallt nach. Nicht nur als biografische Zäsur, sondern auch als forschungsleitende Frage: Wie verändert sich Identität, wenn das Fundament, auf dem sie jahrzehntelang gebaut wurde, bricht?
Diese Ausgabe meines neuen LinkedIn-Newsletters möchte ich deshalb zum Anlass nehmen, meine wöchentlichen LinkedIn-Reflexionen mit einer tiefergehenden Auseinandersetzung zu verbinden. Was bedeutet es, ein Familienunternehmen zu verlieren? Was bleibt – an Werten, an Verantwortung, an Identität? Und welche Lehren lassen sich daraus für die Gestaltung der Unternehmensnachfolge ziehen?
Teil 1: Die biografische Dimension von Nachfolge

Zwischen Herkunft und Zukunft: Wer in ein Familienunternehmen hineingeboren wird, trägt mehr als nur Verantwortung – er oder sie trägt oft auch ein gelebtes Selbstbild.
Wenn wir in der Forschung über Unternehmensnachfolge sprechen, argumentieren wir häufig auf einer strukturellen, manchmal auch funktionalistischen Ebene. Wir analysieren Governance-Strukturen, psychologische Ownership-Theorien, Agency- oder Stewardship-Modelle, ökonomische Effekte. Was dabei oft zu kurz kommt, ist der menschliche Bruch, der mit dem Verlust des Unternehmens einhergeht. Annemarie Heyl spricht im Interview davon, dass sie sich mit dem Ende des Familienunternehmens „ein Stück Identität genommen“ fühlte. Diese Aussage ist tiefgründiger, als es zunächst scheint. Denn in vielen Familienunternehmen verschmelzen Rolle, Herkunft und Zukunftsperspektive zu einem kollektiven Selbstbild: „Ich bin Unternehmerkind – also werde ich eines Tages auch Unternehmerin sein.“ Diese Form der sozialen Prädestination ist sowohl Quelle von Sinn als auch von Druck.
In meiner Forschung beobachte ich immer wieder, dass es nicht nur um die Frage geht, ob jemand übernehmen will oder kann – sondern ob er oder sie es „dürfen darf“. In vielen Fällen sind es implizite familiäre Erwartungen, tradiertes Rollenverständnis und ein festgeschriebenes Narrativ, das kaum Raum für Alternativen lässt. Die Biografie wird dabei zur strategischen Ressource – oder zur emotionalen Hypothek. Annemarie Heyl durchlebte beide Seiten: erst die Hoffnung, dann der Bruch, schließlich der Neuaufbau.
Genau hier setzt mein Forschungsinteresse an: Was passiert, wenn diese Kontinuität unterbrochen wird? Wenn keine Nachfolgerin bereitsteht oder – wie im Fall Heyl – die Strukturen so marode sind, dass eine Fortführung illusorisch erscheint? Welche Handlungsoptionen bleiben? Und welche Rolle können externe Nachfolger oder Übergangsmanager in diesem Moment einnehmen?
Teil 2: Familienunternehmen als Hülle – oder als kollektives Gedächtnis?

Manche Unternehmen sind mehr als Organisationen – sie sind Speicher von Geschichte, Erinnerungen und Werten. Doch was passiert, wenn die Hülle leer wird?
Annemarie Heyl sagt in einem bemerkenswerten Satz: „Das Unternehmen ist nur ein Konstrukt, eine Hülle, die man erst mit Leben füllt oder es auch entzieht.“ Dieser Satz lässt sich kaum treffender formulieren – und doch ist er für viele Familienmitglieder eine Provokation. Denn in der erlebten Realität vieler Familienunternehmen ist das Unternehmen mehr als eine wirtschaftliche Einheit. Es ist Heimat, Herkunft, Projektionsfläche und generationenübergreifendes Narrativ. Es erzählt nicht nur die Geschichte der Gründerinnen und Gründer, sondern auch die Mythen und Werte, die über Jahrzehnte tradiert wurden: Disziplin, Innovationsgeist, Verantwortung für Mitarbeitende, regionale Verbundenheit.
In meiner Forschung beobachte ich, dass insbesondere in Mehrgenerationenunternehmen dieses kollektive Gedächtnis zum unsichtbaren Rahmen des Handelns wird. Es formt nicht nur Entscheidungen, sondern auch Denkweisen: „Das haben wir immer so gemacht“, ist nicht Ausdruck von Trägheit, sondern ein Akt der Loyalität gegenüber der gelebten Geschichte. Der Bruch mit dem Unternehmen – sei es durch Verkauf, Insolvenz oder bewusste Übergabe an externe Nachfolger – ist daher oft auch ein Bruch mit der eigenen Vergangenheit. Und genau deshalb fällt er so schwer.
Wenn wir also über Unternehmensnachfolge sprechen, müssen wir differenzieren: zwischen dem formalen Übergang von Eigentum oder Verantwortung – und dem informellen Übergang von Identität, Geschichte und Zugehörigkeit. In der Theorie nennen wir das „emotional ownership“. Für Annemarie Heyl war das emotionale Eigentum offenbar stärker als jedes formale Beteiligungsrecht. Ihre Identifikation mit dem Unternehmen war nicht juristisch abgesichert, sondern biografisch eingeschrieben. Das ist kein Einzelfall, sondern eine wiederkehrende Konstellation, die wir auch bei vielen sogenannten „Next Gens“ beobachten – gerade bei denen, die nicht aktiv übernehmen.
Die Konsequenz für die Praxis ist gravierend: Wenn wir externe Nachfolge oder andere Übergabeformen gestalten wollen, müssen wir diese emotionalen und symbolischen Dimensionen mitdenken. Wer nur auf Cashflow, Marktanteile oder Restrukturierungsoptionen schaut, verfehlt den Kern.
Teil 3: Der Mythos vom geborenen Unternehmer – und warum manche Rollen uns übergestülpt werden

Nachfolge ist kein Erbgut. Der Weg ins Unternehmertum sollte eine Wahl sein – kein unausgesprochenes Schicksal.
In der Familienunternehmensforschung ist immer wieder von der „Prädestination“ der Nachfolge die Rede. Gemeint ist das unausgesprochene Selbstverständnis, mit dem Kinder – oft schon im Grundschulalter – darauf vorbereitet werden, einmal das Ruder zu übernehmen. Nicht als Option, sondern als Weg, der sich vermeintlich „natürlich“ ergibt. Es ist ein leiser, aber starker Druck. Was wie Vertrauen klingt („Du schaffst das!“), wird zur Last, wenn eigene Interessen oder Zweifel nicht vorgesehen sind. Die Rolle ist vergeben, bevor der eigene Charakter geformt ist.
Annemarie Heyl beschreibt dies eindrucksvoll. Sie war nicht formal beteiligt, nicht geschäftsführend, nicht rechtlich verantwortlich – und doch tief verwoben mit der Rolle der Nachfolgerin. Als das Unternehmen ins Wanken gerät, beschreibt sie ihre Reaktion mit einem einzigen Wort: „Weinen.“ Nicht betriebswirtschaftliche Ratlosigkeit, sondern tiefer emotionaler Verlust. Denn was zusammenbricht, ist nicht nur ein Geschäftsmodell, sondern eine biografische Erwartung: „Ich hatte mir meine Zukunft als Familienunternehmerin ausgemalt.“
Dieser Satz verweist auf ein fundamentales Dilemma vieler Unternehmerkinder: Sie glauben, das Unternehmen übernehmen zu müssen, um sich selbst zu verwirklichen – und merken dann, dass genau diese Erwartung sie daran hindert. In meiner Forschung wird dies besonders deutlich bei Familienunternehmen, in denen eine oder mehrere Nachfolgegenerationen durch Krankheit, Konflikte oder externe Krisen (z. B. Pandemie, Markteinbruch) plötzlich „ihre“ Rolle nicht mehr erfüllen können. Die daraus resultierende Leere ist nicht nur betriebswirtschaftlich bedrohlich – sie ist existenziell.
Was können wir daraus lernen?
Erstens: Wir müssen endlich aufhören, Unternehmertum als genetische Disposition zu verklären. Unternehmerische Verantwortung ist kein Erbe wie Haarfarbe oder Körpergröße, sondern eine bewusste Entscheidung. Auch in Familienunternehmen. Die Vorstellung, dass jemand „dazu geboren“ sei, verhindert nicht nur kritische Selbstreflexion, sondern produziert implizite Schuldgefühle, wenn dieser Weg scheitert. Heyl beschreibt genau das: die Spannung zwischen der inneren Prägung und dem äußeren Zusammenbruch.
Zweitens: Die Forschung muss stärker biografisch und psychologisch denken. Wir brauchen mehr qualitative, tiefenstrukturelle Arbeiten, die nicht nur Macht- und Eigentumsverhältnisse erfassen, sondern auch Erzählmuster, narrative Identitäten und familiäre Rollenbilder analysieren. Nur so können wir verstehen, warum manche Übergaben gelingen – und andere trotz bester Beratung scheitern.
Drittens: Beratung, Coaching und Management müssen diese Reflexion aktiv begleiten. Der Nachfolgeprozess ist kein Excel-Modell, sondern eine biografische Weggabelung. Wer hier begleitet, braucht nicht nur ökonomisches Wissen, sondern Empathie, systemisches Denken und manchmal auch Mut zur Konfrontation.
Teil 4: Das Ende als Anfang – über den kreativen Moment der Krise und die Rolle externer Nachfolger

Jede Krise birgt auch einen Keim des Neuanfangs. Wer loslässt, schafft Raum für etwas Neues – manchmal kraftvoller als je zuvor.
Der wohl kraftvollste Gedanke im Interview mit Annemarie Heyl liegt in der paradoxen Erfahrung, dass der Zusammenbruch des Familienunternehmens nicht das Ende war – sondern der Anfang. Sie nennt es rückblickend „die krasseste Schule“, eine Erfahrung, die sie nicht missen möchte. Und sie formuliert eine Haltung, die ich in meiner Forschung als zentrales Element erfolgreicher externer Nachfolge identifiziert habe: „Ich mache mir Gedanken um eine positive Zukunft – auch ohne Unternehmen.“
Diese Perspektive, aus dem Verlust kreative Energie zu ziehen, ist nicht selbstverständlich. Viele Familienunternehmen, die in die Krise geraten, erleben Lähmung, Ohnmacht, Schuldzuweisungen. Und auch externe Nachfolger, Interimsmanager oder Investoren treten oft in ein Umfeld ein, das nicht primär nach Lösungen sucht, sondern nach Erklärungsmustern für das Scheitern. Die Kunst besteht darin, die Krise nicht zu bagatellisieren – und gleichzeitig in ihr einen Möglichkeitsraum zu entdecken.
In meiner Forschung arbeite ich mit einem Modell, das diesen Moment als „Threshold Phase“ beschreibt – als Schwellenzustand, in dem das Alte nicht mehr trägt und das Neue noch nicht stabil ist. Genau hier können externe Nachfolger eine besondere Rolle spielen. Sie sind nicht belastet durch familiäre Rollenerwartungen, nicht verstrickt in vergangene Konflikte, nicht emotional mit dem alten Narrativ verwoben. Und gerade deshalb können sie Brücken schlagen: zwischen gestern und morgen, zwischen Familie und Belegschaft, zwischen Verlust und Neuanfang.
Annemarie Heyl hat diese Rolle in gewisser Weise selbst eingenommen – nur eben nicht als klassische externe Nachfolgerin, sondern als transformierte Unternehmerin. Ihr Weg führte nicht zurück ins alte System, sondern in ein neues, selbst geschaffenes unternehmerisches Konzept: Kale & Me. Die Lehren aus der Krise – Werteorientierung, Trennung von Beruf und Familie, resilienter Umgang mit Wandel – wurden nicht verdrängt, sondern integriert. Das ist unternehmerisches Lernen im besten Sinne.
Für die Praxis heißt das: Wir sollten externe Nachfolger nicht als Übergangslösungen sehen, sondern als potenzielle Impulsgeber für eine neue Phase. Sie brauchen die Kompetenz, mit Unsicherheit, Ambiguität und emotionaler Komplexität umzugehen – und die Fähigkeit, neue Erzählungen zu etablieren, die jenseits der Gründergeneration anschlussfähig sind.
Das Ende eines Familienunternehmens muss nicht das Ende der unternehmerischen Biografie sein. Es kann der Beginn eines tiefer verankerten, reflektierteren und bewussteren Unternehmertums sein.
Teil 5: Rückblick, Ausblick und die persönliche Verbindung
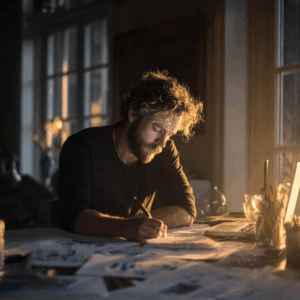
Forschung beginnt oft mit einer persönlichen Frage. Und manchmal endet sie dort auch – mit einer Antwort, die tiefer geht als gedacht.
Wenn ich auf meine eigenen Beiträge der vergangenen Woche zurückblicke, dann kreisen viele Gedanken um ein zentrales Motiv: den Umgang mit Verantwortung – in der Forschung, in der Familie, in der Führung. In einem meiner privaten LinkedIn-Posts ging es um genau diesen inneren Spagat: Wie gelingt es, beruflich wirksam zu bleiben, ohne die persönliche Integrität zu verlieren? Wie gelingt es, Wandel nicht nur zu gestalten, sondern auch zuzulassen?
Das Interview mit Annemarie Heyl hat mir in dieser Hinsicht mehr gegeben als viele Fachartikel. Es ist eine Einladung, den Bruch nicht als Scheitern zu sehen, sondern als Teil eines Reifungsprozesses. Es erinnert mich auch an meine eigene Forschung, in der ich externe Nachfolge nicht als Ersatzlösung begreife, sondern als bewusste Neuausrichtung eines Systems, das an Grenzen gestoßen ist.
In meiner DBA-Thesis habe ich drei zentrale Erkenntnisse gewonnen, die sich durch die Gespräche mit Unternehmerinnen und Unternehmern wie Heyl bestätigen lassen:
Erstens: Nachfolge ist keine bloße Transaktion, sondern ein Transformationsprozess. Es geht nicht nur darum, wer führt – sondern auch, wie geführt wird und warum überhaupt.
Zweitens: Familienunternehmen brauchen neue Narrative, wenn das Alte nicht mehr trägt. Diese Narrative können nicht von außen verordnet, aber durch externe Impulse angestoßen werden. Und manchmal ist es genau dieser Impuls – der frische Blick, die andere Biografie, die systemische Distanz –, der ein Unternehmen in die nächste Generation bringt.
Drittens – und vielleicht am wichtigsten: Auch wenn das Unternehmen scheitert, kann die Idee von Verantwortung weiterleben. Nicht das Unternehmen macht uns zu Unternehmern, sondern unser Handeln. Diese Haltung zieht sich durch Heyls Lebenslauf wie ein roter Faden. Und sie ist auch der Grund, warum Kale & Me heute mehr ist als ein Anbieter von Säften: Es ist ein wertegetriebenes Unternehmen mit einem starken Sinn für Kultur, Wandel und Menschlichkeit.
Ich nehme aus dieser Woche also drei Impulse mit:
-
Als Forscher: Wir müssen mehr zuhören und weniger kategorisieren. Geschichten wie die von Heyl zeigen, wie vielschichtig, widersprüchlich und inspirierend Unternehmensnachfolge sein kann.
-
Als Unternehmer: Es ist unsere Aufgabe, Räume zu schaffen, in denen Wandel möglich ist – auch wenn er unbequem ist. Externe Nachfolger sind nicht Störfaktoren, sondern manchmal genau die richtige nächste Generation.
-
Als Mensch: Wir sollten Mut machen. Auch wenn das Familienunternehmen endet, ist nicht alles vorbei. Vielleicht beginnt dann erst das, was wirklich zählt.
Ich freue mich, dass du diesen neuen Newsletter bis hierher gelesen hast. Vielleicht hast du selbst Erfahrungen mit familiärer Verantwortung, mit Nachfolgeprozessen oder mit biografischen Brüchen gemacht. Vielleicht kennst du auch jemanden, der gerade an diesem Punkt steht. Teile diesen Beitrag gerne weiter, kommentiere oder schreibe mir direkt. Wenn du meinen Newsletter abonnieren möchtest, klicke einfach auf „Folgen“.
In der kommenden Woche spreche ich über die Frage, wie externe Nachfolger mit impliziten Loyalitätskonflikten umgehen – und warum manchmal gerade emotionale Distanz der größte Dienst an einem Familienunternehmen ist.
Bis dahin – euer
Christian